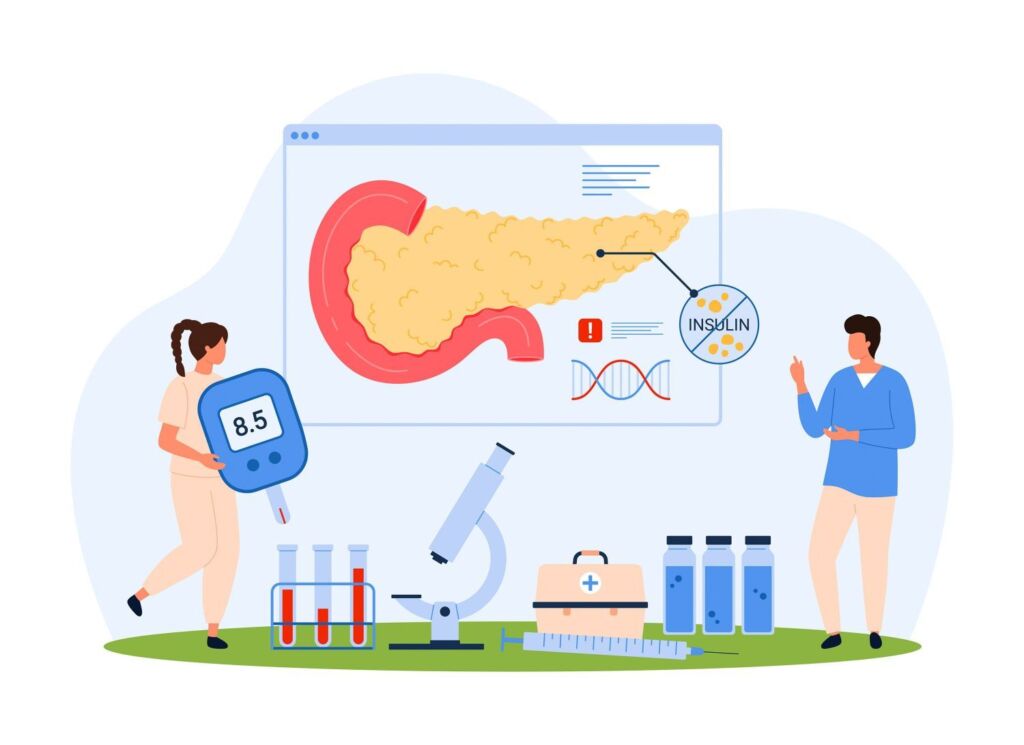Eine ausgewogene Ernährung und genügend Bewegung halten das Verdauungsorgan fit. Vorsorgeuntersuchungen können das Risiko für Darmkrebs massiv reduzieren.
Text: Helga Kessler
Es ist ein merkwürdiges Organ: Auf einen fünf bis sechs Meter langen dünnen Schlauch mit vielen Falten und Zotten folgt ein circa ein Meter langer, dickerer Abschnitt. Ein Muskel verschliesst das Ganze gasdicht. Der Ort der Verdauung wirkt auf den ersten Blick sehr simpel, ist aber äusserst komplex: Im Darm werden nicht nur Nährstoffe aufgeschlossen und aufgenommen, sondern auch Krankheitserreger abgewehrt, Hormone ausgeschüttet, Enzyme und Vitamine produziert. «Funktioniert alles reibungslos, ist der Darm gesund», sagt der Leitende Arzt Michael Scharl von der Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie. Damit der Darm gesund bleibt, müssen die geschätzt 40 Quadratmeter umfassende Darmschleimhaut und das aus Billionen von Bakterien bestehende Mikrobiom perfekt zusammenspielen.
Training für das Immunsystem
Die Schleimhaut ist gleichzeitig Barriere und Ort des Austauschs: Sie hindert die Mikroorganismen einerseits daran, sich im Körper auszubreiten, andererseits steht sie mit ihnen in Kontakt und trainiert so das Immunsystem. «Je mehr verschiedene Bakterienarten es hat, desto besser», weiss Michael Scharl. Im Dünndarm schüttet die Schleimhaut Verdauungsenzyme aus und nimmt Nährstoffe auf, im Dickdarm gewinnt sie Wasser zurück. Drüsenzellen produzieren den Schleim, der Nahrungsbrei und Stuhl gut rutschen lässt. Blutgefässe unter der Schleimhaut transportieren zusammen mit den Lymphgefässen verdaute Nährstoffe ab. Millionen von Nervenzellen regulieren weitgehend unabhängig vom Gehirn die Tätigkeit der Darmmuskulatur, steuern den Blutfluss und die Ausschüttung von Hormonen.
Ist die Nervenregulation im Darm gestört, macht sich das in Form von Bauchschmerzen bemerkbar, etwa bei einem Reizdarm. Eng gekoppelt ist das körperliche Wohlbefinden mit der Bakterienbesiedlung im Darm. Rund zwei Kilo Mikroorganismen tummeln sich vor allem im Dickdarm. Quasi als Gegenleistung für die Unterkunft tragen Bakterien des Darmmikrobioms etwa zur Synthese des Glückshormons Serotonin oder des Schlafhormons Melatonin sowie zur Synthese der Vitamine E, B12 und Folsäure bei. Die Darmbakterien sind beteiligt an der Synthese von Gallensäuren, und sie bauen Ballaststoffe ab, die der Mensch sonst nicht aufnehmen könnte. Aus Zellulose stellen sie kurzkettige Fettsäuren her – diese wiederum dienen genau den Bakterien als Futter, die Krankheitserreger beseitigen und vor Entzündungen schützen.