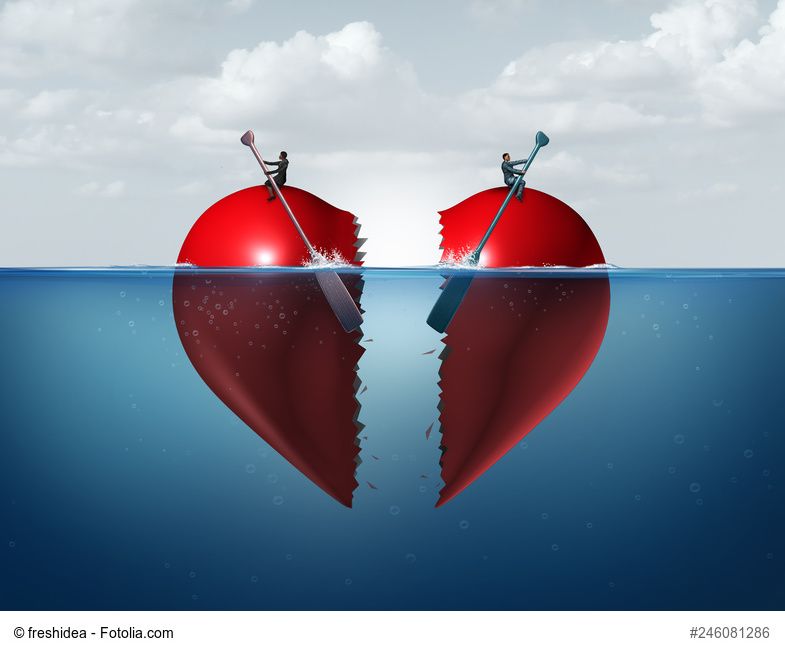Das Takotsubo-Syndrom, auch als «Syndrom des gebrochenen Herzens» bekannt, ist eine noch immer weitgehend unerforschte Krankheit. In einem Kooperationsprojekt hat eine Forschergruppe aus Kardiologen des UniversitätsSpitals Zürich unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. Christian Templin und Neurowissenschaftlern der Universität Zürich nun erstmals Nachweise erbracht, dass funktionelle Veränderungen im Gehirn von Takotsubo-Patienten existieren, die in Zusammenhang mit dieser Erkrankung stehen.
Das Takotsubo-Syndrom (TTS) verursacht ähnliche Symptome wie ein Herzinfarkt, muss aber ganz anders behandelt werden. Denn anders als beim Herzinfarkt ist beim TTS kein Gefäss verschlossen, sondern die Pumpfunktion des Herzens akut gestört, bei einem Teil der Patienten führt dies sogar zu Herzversagen und zum Tod. Als Auslöser für das TTS gelten u.a. Stress, wie Mobbing am Arbeitsplatz, aber auch starke emotionale Belastungen wie der Tod eines Angehörigen; auch extrem freudige Ereignisse (z.B. eine Geburtstagsparty) können ein Auslöser für das TTS sein. In den letzten Jahren wurden zudem körperliche Belastungen gefunden, die für das TTS verantwortlich sind, z.B. Operationen, Asthmaanfälle, eine Krebsbehandlung und Stürze.
Erstmals starke Hinweise auf Zusammenhang von Hirn und Herz bei TTS
Längere Zeit ging man davon aus, dass sich das TTS nur auf das Herz beschränkt. 2015 konnte in einer internationalen Studie unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. Christian Templin, Leiter der Akuten Kardiologie am UniversitätsSpital Zürich, erstmals gezeigt werden, dass neurologische und psychiatrische Erkrankungen sehr wahrscheinlich eine Rolle beim TTS spielen. Daraus folgerten die Wissenschaftler, dass es eine Hirn-Herz-Assoziation geben könnte. In einem Kooperationsprojekt untersuchten Forscherinnen und Forscher der Kardiologie des USZ und des Neuropsychologischen Instituts der Universität Zürich nun die Hirnareale von TTS-Patienten mittels modernster funktioneller Magnetresonanztomographie und verglichen sie mit gesunden Probanden. Dabei zeigte sich, dass bei den TTS-Patienten die Aktivität zwischen den Hirnregionen, die für die Verarbeitung emotionaler Prozesse zuständig sind, reduziert war. Untersucht wurden insbesondere die Amygdala, der Hippocampus und der Gyrus cinguli, die für die Emotionskontrolle und Motivation, für das Lernen und das Gedächtnis zuständig sind. Amygdala und Gyrus cinguli sind zudem an der Kontrolle des vegetativen Nervensystems und der Regulation der Herzfunktion beteiligt, der Gyrus cinguli ist auch bei Depressionen und Stimmungsschwankungen involviert. Zusätzlich zeigten auch das Default-Mode-Netzwerk des Gehirns (Ruhezustandsnetzwerk), das bei Ruhe oder Nichtstun aktiv ist (z.B. wenn die Augen geschlossen sind oder beim Tagträumen) als auch das limibische System (das Zentrum der Verarbeitung von Gefühlen) bei den Takotsubo-Patienten eine reduzierte funktionelle Ruhe.
«Wir konnten in unserer Studie zeigen, dass tatsächlich funktionelle Veränderungen im Hirn von Patienten mit Takotsubo-Syndrom bestehen und von einer Hirn-Herz-Assoziation beim TTS ausgegangen werden muss. Das ist eine wichtige Erkenntnis, auf der wir aufbauen können. Nun sind weitere Schritte nötig, um mehr über die Zusammenhänge zu erfahren», fasst Prof. Christian Templin, einer der Leiter der Studie und Initiator des weltweit grössten Internationalen Takotsubo-Registers die Erkenntnisse aus der Studie zusammen.
Entscheidend für den Erfolg der Studie und die neuen Erkenntnisse über das Takotsubo-Syndrom war die fachübergreifende Zusammenarbeit von Kardiologen und Neurowissenschaftlern. Bisher hatten sich fast ausschliesslich Kardiologen mit der Krankheit befasst und waren nur auf das Herz fokussiert. Die Studie habe deshalb auch gezeigt, so Templin, dass man unbedingt weiter interdisziplinär arbeiten müsse, um den Mechanismus der Krankheit weiter zu erforschen. Dabei, so Templin, sei die «Neurokardiologie» ein sehr wichtiges Gebiet in der Medizin, dem man viel mehr Aufmerksamkeit schenken müsse, um das komplexe Zusammenspiel zwischen Hirn und Herz zu verstehen.
Studie: